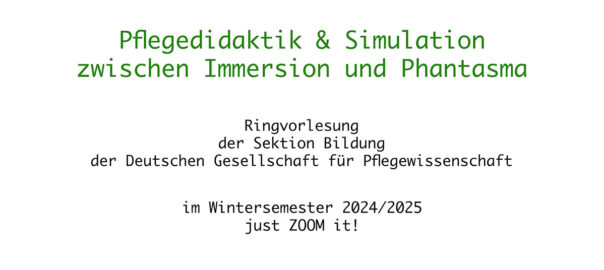Gemeinsam mit meiner Kollegin Prof. Dr. Dorothee Lebeda konnte ich mit Studierenden den Ort Alt Rehse im Rahmen einer Exkursion besuchen. Es war ein Besuch an einem Ort der Täter des Nationalsozialismus. In Alt Rehse entstand nach der „Machtergreifung“ der NSDAP die „Führerschgule der Deutschen Ärzteschaft“. Sie diente zwischen 1935 und 1943 der „weltanschaulichen Schulung“ von Ärzten, Ärztinnen, Apothekern und Hebammen.
Einem wahrhaft pittoresken Ort begegnete ich in Alt Rehse. Fachwerkhäuser machen deutlich: Hier ist Heimat. Auf vielen Balken der Häuser ist zu lesen „erbaut im 3. Jahr“ (o.ä.); die neuen Machthaber machten eine neue Zeitzählung auf (erbaut also im Jahr 1935). Sehr viel Grün, eine wunderschöne Naturlandschaft am Tollensesee. Und mittendrin, im Schlosspark, steht das Gemeinschaftshaus, das seinerzeit wohl für „90 bis 100 Schulungskurse mit ungefähr 12000 Teilnehmern aus dem medizinischen Umfeld“ diente (Stommer 2017). Heute befindet sich in dem denkmalgeschützten und restaurierten Gebäude ein luxuriöses Hotel, das sich an Yoga und Ayurveda suchende Gäste wendet.
Unser Besuch galt zunächst der „Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Alt Rehse“, das sich in einem anderen Gebäude unweit des Schlossparks befindet. Und wenn ich das heute schreibe, müsste es wohl heißen: befand. Das Haus, in dem die Gedenkstätte in den vergangenen Jahren untergebracht war, wurde verkauft. Die Begegnungsstätte mitsamt ihrer Ausstellung zur Geschichte der „Führerschule“ und des Ortes selbst werden voraussichtlich ein anderes Gebäude am Rande des Schlossparks beziehen können.
Dies ist zu hoffen. Bislang begegnet dem touristischen Besucher des Ortes kein Hinweis auf die ehemalige „Führerschule“ und die Bedeutung des Dorfes für die ideologische Schulung von führenden Personen der Gesundheitsberufe im Sinne der Machthaber und ihrer Rassenidologie. Das heimatverbundene Idyll, das dem Flaneur im Ort begegnet, ist nicht in der Geschichte des Orts gewachsen, sondern vielmehr seinerzeit im Rahmen der Errichtung der ideologischen Erziehungsstätte als Exempel für ein deutsches Dorf neu gestaltet und aufgebaut worden. Um dies begreifen zu können und den Ort unter diesen Vorzeichen zu beschreiten, benötigt es die Hinweise der Gedenkstätte. Wir konnten bei einer Führung durch das für Personen, die keine Hotelgäste sind, normalerweise verschlossene Gelände einen Überblick und Ein-Druck gewinnen, wie sich die damalige Ideologiestätte in den Ort eingebaut hat und uns bei unseren Schritten erscheint. Geholfen hat uns dabei sicherlich auch ein Film, den wir vorweg anschauen konnten. Der Film wurde von einem damaligen frühen Schulungsteilnehmer gemacht und zeigt Bilder aus dem Dorf und vor allem vom Tagesablauf der Schulungsteilnehmer (zum Beispiel Auskehren der Gemeinschaftsunterkunft, Fahnenappell, Postausgabe).
Ich bin durch den Besuch sehr neugierig geworden. Und ich hoffe, dass die „Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Alt Rehse“ ein neues Zuhause findet, um auf die Geschichte des Ortes und ihre Bedeutung für unser heutiges Zusammenleben in einem demokratisch verfassten Staat hinzuweisen. Verschlungen habe ich bereits einen sehr interessanten Sammelband, der in der Folge einer Fachtagung zu dieser „Führerschule der deutschen Ärzteschaft“ erschienen ist. Ich habe den Band in der zweiten Auflage vorliegen und gelesen – und ich möchte ihn hiermit auch gerne empfehlen:
Rainer Stommer (Hrsg.): Medizin im Dienste der Rassenideologie. Die „Führerschule der Deutschen Ärzteschaft“ in Alt Rehse. Berlin: Christoph Links Verlag. 2. aktualisierte und erweiterte Ausgabe. 2017.
Ich gehe davon aus, nicht das letzte Mal mit der Kollegin Dorothee Lebeda in Alt Rehse mit Studierenden gewesen zu sein.
Fotos: Altes Pfarrhaus (links), Wohnhaus (rechts), (c) Roland Brühe